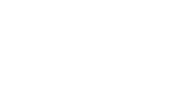Leitfaden für Kettenantriebe und Kettenarten: Wissenswertes für Ingenieure
Kettenantriebe zeichnen sich als eine wesentliche Lösung für die mechanische Kraftübertragung aus und werden häufig eingesetzt, um Leistung zwischen Komponenten zu übertragen – sei es über lange Strecken (wie bei fünf Stockwerke hohen Schiffsmotoren) oder kurze (wie bei Fahrrädern). Sie zählen zu den fünf häufigsten Methoden der mechanischen Leistungsübertragung, neben Kupplungen, Zahntrieben, Riemenantrieben und Spindelantrieben. Jede Methode hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, weshalb Ingenieure diese Faktoren sorgfältig abwägen müssen, um die optimale Wahl für spezifische Anwendungen zu treffen. Dieser Artikel geht auf die Grundlagen von Kettenantrieben, ihre Einteilung, gängige Kettenarten, Auswahlkriterien sowie wesentliche Vorteile und Nachteile ein.
Was sind Kettenantriebe?
Ein Kettenantrieb ist ein mechanisches System zur Kraftübertragung, das eine Kette verwendet, um Leistung von einem Ort zu einem anderen zu übertragen. Ein typischer Kettenantrieb besteht aus zwei oder mehr Zahnrädern (mit Zähnen versehene Räder) und einer Kette selbst – wobei die Öffnungen in den Kettengliedern über die Zähne der Zahnräder passen.
Wenn der Antrieb (z. B. ein Elektromotor oder ein Verbrennungsmotor) rotiert, dreht er das am Wellenschaft befestigte Kettenrad. Diese Rotation bewegt die um das Kettenrad gewickelte Kette, die dadurch eine mechanische Kraft auf die angetriebene Welle ausübt und somit effektiv Leistung überträgt.
Wichtige Vergleiche mit anderen Übertragungsmethoden
Im Vergleich zu Riemenantrieben: Im Gegensatz zu Riemenantrieben bieten Kettenantriebe absolut schlupffreie Kraftübertragung und gewährleisten somit ein konstantes Übersetzungsverhältnis. Dadurch entfällt das Leistungsübertragungslag, wodurch sie ideal für Anwendungen wie Nockenwellenketten in Verbrennungsmotoren sind. Der einzige Leistungsverlust bei Kettenantrieben entsteht durch Reibung zwischen Kettengliedern und Kettenrädern, was den Wirkungsgrad jedoch immer noch relativ hoch hält.
Im Vergleich zu Zahnradantrieben: Kettenantriebe sind hinsichtlich des möglichen Achsabstands flexibler. Sie sind besonders geeignet, wenn die Wellen weiter voneinander entfernt sind als mit Zahnrädern möglich, bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Zudem kann eine einzige Kette gleichzeitig mehrere Wellen antreiben – eine Eigenschaft, die Zahnräder selten aufweisen.
Arten von Kettenantrieben (nach Funktion)
Kettenantriebe werden anhand ihrer Hauptfunktion in drei Haupttypen eingeteilt, die jeweils auf spezifische Anwendungsbedürfnisse abgestimmt sind:
1. Leistungsübertragende Kettenantriebe
Diese Kettenantriebe sind ausschließlich dafür konzipiert, Leistung zwischen zwei Wellen zu übertragen und lösen eine häufige Herausforderung: Die meisten stromerzeugenden Maschinen (z. B. Motoren in Pumpen) können die erzeugte Leistung am Ort der Erzeugung nicht direkt nutzen.
Gängige Anwendungen: Fahrräder, landwirtschaftliche Maschinen, Kompressoren und Motoren-Nockenwellen – alle verlassen sich auf Leistungsübertragungsketten, um die Leistung vom Erzeuger zum Verbraucherort zu bringen.
2. Fördertechnische Kettenantriebe
Fördertechnische Kettenantriebe sind auf Materialhandhabung spezialisiert. Sie bieten Hunderte von Designs mit angepassten Eigenschaften, wie z. B. geringe Reibung, hohe Temperaturbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, antistatische Eigenschaften oder magnetische Merkmale. Zudem können Ketten mit Anbauteilen ausgestattet werden, um unterschiedlichste Anforderungen zu erfüllen.
Industrielle Anwendung: Wird in der Verpackungsindustrie, der Automobilherstellung, der Lebensmittel- und Getränkeproduktion, der Pharmazie und der Textilindustrie für den effizienten Materialtransport eingesetzt.
3. Hebe- und Zugkettenantriebe
Diese Kettenantriebe werden in Maschinen zum Heben und Senken schwerer Lasten eingesetzt und arbeiten häufig zusammen mit Rollen, um den Kraftaufwand zu reduzieren. Beispiele hierfür sind Kettenzüge (manuell, elektrisch oder pneumatisch), die in Garagen, Werkstätten, auf Baustellen, in Schiffsmaschinenräumen und Fabriken zum Einsatz kommen – sie sind in der Lage, Lasten von bis zu 20 Tonnen zu heben/senken.
Hebeketten lassen sich weiter in zwei Unterkategorien unterteilen:
Ovalketten (Wendelketten): Werden für mittelschwere bis leichte Lasten und niedrige Geschwindigkeiten beim Heben verwendet. Ihre Glieder sind oval und durch Schweißnähte miteinander verbunden. Quadratgliederketten werden gelegentlich als Alternative eingesetzt, jedoch aufgrund ungleichmäßiger Belastungsverteilung und Verknotungsneigung meistens vermieden.
Stiftketten: Bevorzugt für Anwendungen mit hohen Lasten. Jeder Kettenglied besitzt einen Stift in seiner inneren Breite eingebaut, welcher das Verknoten verhindert und die Stabilität sowie Langlebigkeit erhöht. Sie werden häufig bei Schiffyankeern und anderen schweren Hebezeuge eingesetzt.
Gängige Kettentypen in Kettenantrieben
Fünf Kettentypen dominieren industrielle und kommerzielle Anwendungen, jeder mit charakteristischer Struktur und Vorteilen:
1. Rollenketten (Büchsenrollenketten)
Der bekannteste Kettentyp, Rollenketten (oder Büchsenrollenketten), werden breit in der Leistungsübertragung für Fahrräder, Motorräder und Transportgeräte eingesetzt. Sie werden üblicherweise aus unlegiertem Kohlenstoffstahl oder Stahll egierungen hergestellt.
Struktur: Besteht aus Innenplatten (Rollenplatten), Außenplatten (Stiftplatten), Buchsen, Stiften und Rollen. Die Rollen sind gleichmäßig zwischen den Kettengliedern angeordnet und greifen in die Zähne der Kette, um die Kraftübertragung sicherzustellen.
Kernvorteile: Die Rollen drehen sich bei Kontakt mit den Kettenradzähnen nach Bedarf, wodurch Leistungsverluste minimiert werden. Bei Antriebsketten ist die Höhe der Rollenplatten (auf beiden Seiten der Rollen) größer als der Rollendurchmesser – dadurch wird verhindert, dass die Seitenplatten das Kettenrad berühren, und sie wirken gleichzeitig als Führung, um ein Abrutschen der Kette zu vermeiden. Bei Förderketten ist der Rollendurchmesser größer als die Höhe der Seitenstäbe, wodurch Berührungen zwischen Seitenstäben und Förderschienen eliminiert werden, um Reibung zu reduzieren. Mehrsträngige Rollenketten sind für hohe Leistungsanforderungen erhältlich, wodurch niedrigere Geschwindigkeiten und kleinere Teilungen bei gleichen Lastanforderungen ermöglicht werden.
2. Stille Ketten (Innenzahnketten)
Traditionelle Kettenantriebe sind oft laut, wodurch sie für geräuschempfindliche Umgebungen wie geschlossene Räume, Bergwerke oder Wohngebiete ungeeignet sind. Stille Ketten (oder Innenzahnketten) lösen dieses Problem, indem sie leise laufen und gleichzeitig hohe Leistung bei hohen Geschwindigkeiten übertragen.
Aufbau: Aus flachen Platten bestehend, die in Reihen übereinander gestapelt und durch einen oder mehrere Stifte verbunden sind. Die Unterseite jedes Kettenglieds hat ein Profil, das mit den Zähnen des Zahnrads übereinstimmt, um eine gleichmäßige Verzahnung zu gewährleisten.
Leistung: Die Tragfähigkeit, Zugfestigkeit und die Kettenbreite erhöhen sich mit der Anzahl der flachen Platten pro Glied.
3. Blattketten
Die einfachste Kettenart, Blattketten bestehen lediglich aus Stiften und Platten – wobei die Platten abwechselnd als Stiftglieder und Gelenkglieder fungieren. Sie verzahnen sich nicht mit Zahnrädern, sondern laufen stattdessen zur Führung auf Rollen.
Anwendungen: Ideal zum Heben und Ausbalancieren, beispielsweise in Aufzügen, Gabelstaplern, Schwerlaststaplern (Straddle Carrier) und Aufzugsmasten. Diese Maschinen mit niedriger Geschwindigkeit belasten die Ketten mit hohen statischen Lasten und geringen Betriebslasten, wobei Blattketten besonders gut geeignet sind, um Schlagbelastungen und Trägheit zu bewältigen.
Wichtige Anforderung: Muss hohe Zugbelastungen ohne Dehnung oder Bruch standhalten und über ausreichende Duktilität verfügen, um Ermüdungserscheinungen zu widerstehen. Schmierung und Umweltbedingungen müssen bereits bei der Konstruktion berücksichtigt werden.
4. Flachbandketten
Wird ausschließlich zum Fördern eingesetzt, ersetzen Flachkettensysteme Förderbänder und Riemenantriebe – Materialien können direkt auf ihren Gliedern transportiert werden.
Aufbau: Individuelle Glieder bestehen in der Regel aus Stahlplatten mit tonnenförmigen Hohlrippen an der Unterseite. Stifte durchdringen diese Rippen, um benachbarte Glieder zu verbinden, wodurch eine Bewegung nur in eine Richtung möglich ist. Spezielle Flachkettensysteme können seitlich gebogen werden (mittels modifizierter Stiftkonstruktionen), wodurch der Förderer Kurven durchlaufen kann.
Anwendungsbereiche: Eingesetzt in Langsamlauf-Förderanlagen für den Materialtransport in Montagelinien.
5. Konstruktionsstahlketten
In den 1880er Jahren entwickelt, sind Konstruktionsstahlketten für raue Umgebungen und anspruchsvolle Anwendungen konzipiert. Sie bestehen aus warmgewalztem Stahl (manchmal wärmebehandelt für erhöhte Festigkeit) und weisen größere Zwischenräume zwischen den Komponenten auf, um Staub, Schmutz und abrasive Materialien während des Betriebs zu bewältigen.
Moderne Anwendungen: Wird hauptsächlich als Förderketten für Materialtransport verwendet, doch einige dienen auch als Antriebe. Sie finden Anwendung in Förderbändern, Gabelstaplern, Schüttguthebern und Bohrinseln – mit verbesserter Festigkeit, Abriebfestigkeit, Tragfähigkeit und Steigung, um den Anforderungen der modernen Industrie gerecht zu werden.
So wählen Sie die richtige Kettenantriebe aus
Die Auswahl des richtigen Kettenantriebs erfordert die Bewertung der Anwendungsanforderungen, um ungeeignete Optionen auszuschließen. Zu berücksichtigende Schlüsselfaktoren sind:
1. Last
Ermitteln Sie die zu übertragende Leistung – die Kette muss in der Lage sein, die von der Antriebsmaschine erzeugte Leistung zu bewältigen. Genaue Berechnungen sind für die Sicherheit entscheidend, weshalb ein ausreichender Sicherheitsfaktor empfohlen wird.
2. Kettengeschwindigkeit
Nicht alle Kettenantriebe sind für hohe Geschwindigkeiten geeignet; einige sind für niedrige Geschwindigkeiten ausgelegt. Berechnen Sie die erforderliche Geschwindigkeit und stellen Sie sicher, dass diese innerhalb des empfohlenen Bereichs der Kette liegt, um die Auswahl einzugrenzen.
3. Wellenanordnung
Die meisten Kettenantriebe funktionieren nur mit parallelen Wellen. Falls die Wellen nicht ausgerichtet sind, könnten Zahnradantriebe eine bessere Alternative sein.
4. Achsabstand Mitte
Der empfohlene Achsabstand Mitte sollte 30–50 Mal der Kettenteilung entsprechen. Zudem muss ein Mindestumfangswinkel von 120° am kleineren Zahnrad gewährleistet sein; falls das Zahnrad nur wenige Zähne hat, müssen stets mindestens fünf Zähne mit der Kette in Eingriff sein.
5. Einsatzumgebung
Die Umgebung bestimmt den erforderlichen Widerstand der Kette gegen Feuchtigkeit, Schmutz, abrasive Partikel, Korrosion und hohe Temperaturen. Ebenfalls beeinflusst sie Vibrationen, Geräuschpegel und die Dauerfestigkeit. Zum Beispiel werden invertierte Zahnketten (stille Ketten) in geräuschempfindlichen Bereichen bevorzugt.
6. Schmierung
Die meisten Kettenantriebe benötigen Schmierung, um die Verschleißdauer zu verlängern. Art, Größe, Belastung und Geschwindigkeit der Kette bestimmen die Schmiermethode (manuelle Schmierung, Tropfölversorgung, Ölbad oder Zwangsschmierung). Selbstschmierende Ketten sind erhältlich – diese verwenden Buchsen aus ölgetränktem gesinterten Kunststoff oder Metall, um kontinuierliche Schmierung ohne externe Wartung zu gewährleisten.
Vorteile von Kettenantrieben
Kann Drehmoment über lange Strecken übertragen.
Kein Schlupf (im Gegensatz zu Riemenantrieben), wodurch eine gleichmäßige Leistung gewährleistet wird.
Kompakter als Riemenantriebe und passt in relativ kleine Bauräume.
Ein einzelner Kettenantrieb kann mehrere Wellen antreiben.
Vielseitig einsetzbar, auch bei hohen Temperaturen und in unterschiedlichen Umgebungen (trocken, nass, abrasiv, korrosiv usw.).
Reibungsarme Konstruktion, die eine hohe mechanische Effizienz gewährleistet.
Nachteile von Kettenantrieben
Kann nicht mit nicht parallelen Wellen verwendet werden.
Anfällig für Geräusche und Vibrationen während des Betriebs.
Fehlausrichtung kann zu Kettenschlupf führen.
Einige Konstruktionen erfordern eine kontinuierliche Schmierung.
Benötigen in der Regel eine Abdeckung zum Schutz.
Eine periodische Spannungskontrolle (z. B. über Umlenkrollen) ist erforderlich, um die Leistung aufrechtzuerhalten.

 EN
EN
 AR
AR
 FI
FI
 NL
NL
 DA
DA
 CS
CS
 PT
PT
 PL
PL
 NO
NO
 KO
KO
 JA
JA
 IT
IT
 HI
HI
 EL
EL
 FR
FR
 DE
DE
 RO
RO
 RU
RU
 ES
ES
 SV
SV
 TL
TL
 IW
IW
 ID
ID
 SK
SK
 UK
UK
 VI
VI
 HU
HU
 TH
TH
 FA
FA
 MS
MS
 HA
HA
 KM
KM
 LO
LO
 NE
NE
 PA
PA
 YO
YO
 MY
MY
 KK
KK
 SI
SI
 KY
KY